
Männer, die super woke wirken wollen, in der Bahn feministische Literatur lesen, Matcha Latte trinken und Bilder mit weiteren dieser typischen Life-Style-Codes posten, um bei progressiven Frauen zu landen sind momentan ein Phänomen. Der sogenannte ‚performative male‘ ist dabei häufig gar nicht so feministisch wie er scheint. Aus psychoanalytischer Sichtweise ist der komplette Trend jedoch trotzdem als eine positive Entwicklung zu bewerten und warum? Das Argument möchte ich in diesem Beitrag ausformulieren.
In dieser Rubrik „Theorie Shortcut“ möchte ich Euch eine Abkürzung zu wichtigen Theorien und ihre Anwendung in geschichtswissenschaftlichen (Haus-)Arbeiten bieten. Die Grundlagentexte von Theorien und Methodiken erfordern meist ein hohes Maß an Kontextwissen und nutzen komplizierte Fachsprache. Gerade für Anfänger im Geschichtsstudium sollen die Artikel dieser Rubrik einen Fingerzeig auf zentrale geschichtsphilosophische Spannungsfelder sein, anhand derer ihr in Euren eigenen Arbeiten argumentieren könnt. Durch ein einfaches „inwiefern…“ habt ihr noch keine offene und geeignete Fragestellung. Dieser Artikel ist ein bisschen zeitgenössischer, mit den psychoanalytischen Konzepten von Žižek, Zupančič und Lacan, können aber auch Historiker:innen gut argumentieren.
Sie ziehen sich für den ‚female gaze‘ an, tragen Baggy-Jeans, Perlenketten, Ringe und Tote-Bags, lesen Bücher von Bell Hooks und inszenieren sich bewusst, um öffentlich zu zeigen, dass sie zu den „Guten“ gehören und nicht zu den „Alphamännern“. Diese Selbstinszenierung provoziert sowohl bei Männern als auch bei Frauen unterschiedliche Reaktionen: Sympathie, Skepsis, manchmal auch Ablehnung. Authentizität lässt sich dabei erst im persönlichen Kontakt überprüfen. Genau diese Ambivalenz macht das Phänomen interessant – und überraschenderweise psychoanalytisch erklärbar.
Unterscheidungen von dem was Männlichkeit und Weiblichkeit in der Psyche des Menschen ausmacht, sind bereits lange Gegenstand von Debatten in der Psychoanalyse. Bereits die Psychoanalytikerin Joan Rivière stellte 1929 in ihrem Aufsatz „Womanliness as a Masquerade“ die These auf, Weiblichkeit habe keine Essenz, sondern sei eine Maske. Weiblich-Sein bedeute, eine Rolle zu spielen – oftmals, um die eigene Position abzusichern.
Untermalt wird diese Argumentation häufig durch folgendes Beispiel: Eine Frau, die einen brillianten Vortrag in einem männlich-dominierten Feld hält. In diesem Vortrag ist sie sehr luzide und klar pointiert. Doch danach bemerkt sie selbst an sich, wie auffällig kokett sie sich gegenüber männlichen Kollegen nach dem Vortrag verhalten hat. So würde sie sich im Alltag nicht verhalten. Rivière erklärt diese unbewusste Verhaltensweise als Schutzmechanismus. Die Frau spürt, dass ihr Erfolg ‚männlich‘ und als Gefahr für die Männerdomäne gelesen werden könnte. Sie setzt diese Maske der Weiblichkeit auf, um zu signalisieren: Keine Sorge, ich bin nicht bedrohlich, ich bin noch immer eine feminine Frau.
Was hat das mit unseren heutigen ‚performative men‘ zu tun? Rivière hat damals festgehalten, dass die Performanz von Weiblichkeit nicht ‚falsch‘ ist, die Inszenierung ist die Essenz von Weiblichkeit. Das wird wichtig, wenn man es im Kontrast zur Männlichkeit stellt. Der Psychoanalytiker Jacques-Marie Émile Lacan erweitert die These Rivière’s zu einer der kontroversesten Thesen der Philosophiegeschichte, indem er sagt: „Woman don’t exist“. Womit er natürlich nicht meint, dass es keine Frauen gibt, sondern dass es eine Weiblichkeit hinter der Inszenierung jener, nicht gibt. Es gibt auch keine Unterschiede in dem, wie sie gegenüber Männern und anderen Frauen vorgespielt wird. Einige psychologische Studien haben uns z.B. gezeigt, dass Frauen wenn sie an einem Pärchen vorbeigehen, intensiver die andere Frau anschauen und nicht den Mann. Sie überprüfen die Performanz von Weiblichkeit.
Männlichkeit hingegen gilt traditionell als authentisch und substantiell, obwohl sie ebenso performativ ist. Alenka Zupančič hat darauf hingewiesen, dass übermäßige Männlichkeitsperformanz – etwa durch exzessives Bodybuilding oder Steroidkonsum – lächerlich wirkt, weil sie die Illusion des „Echten“ zerstört. Während Weiblichkeit gerade in der Inszenierung liegt, beruht Männlichkeit auf dem Glauben an eine authentische Inszenierung. Das macht toxische Männlichkeit so fundamental anders zu toxischer Weiblichkeit. Männlichkeit = Glauben, Weiblichkeit = Maske. Wer zu stark performt, verrät, dass auch er nur spielt und dadurch wirkt er überheblich. Eine einfache Analogie wäre, ein Zauberer weiß, dass er Tricks macht (Femininität) und das Publikum muss glauben, dass es echte Magie gibt (Männlichkeit).
Die psychoanalytische Unterscheidung von Männlichkeit und Weiblichkeit ist dabei keine Rückkehr zur Binarität der Geschlechter.
Männlichkeit und Weiblichkeit wird in der Psychoanalyse nicht einfach als eine biologische Kategorie verstanden, sondern als das (Unter-)Bewusstsein strukturierende Differenzkategorie. Das andere Geschlecht als das ‚Andere‘ stabilisiert die eigene Identität. Dadurch verdeutlicht sich für Zupančič vielmehr die strukturelle Unmöglichkeit Geschlecht als naturgegeben zu denken.
In diesem Sinne ist auch der Trend des ‚performative male‘ zu verstehen. Performanz wird intrinsisch als ‚weiblich‘ verstanden, weshalb sich auch Männer über ‚performative males‘ echauffieren. Andere Männer anzugreifen und ihnen die Männlichkeit abzusprechen, erhöht selbst den Glauben anderer und der Person selbst, dass jener Mann auch ein ‚wahrer‘ Mann ist. Unser Phänomen des ‚performative male‘ weiß, dass er Dinge nur vorspielt, grenzt sich von diese toxischen Bild ab, und inszeniert sich auf diese Weise als guter Mann. Der ‚performative male‘ zeigt die Unlogiken des klassischen Männlichkeitsbildes auf. Was passiert wenn Männer nicht mehr glauben, dass es ‚wahre‘ Männlichkeit gibt? Träte dieser unwahrscheinliche Fall ein, bräche das ganze System zusammen. Männer brauchen Frauen als das „Andere“, um ihre eigene Rolle in der Gesellschaft zu stabilisieren. Wie sie angegriffen wird, zeigt sich z.B. durch den ‚performative male‘, aber auch durch Frauen, die wissen, dass Weiblichkeit eine Maskerade ist, denn diese Einsicht gibt ihnen die Freiheit zu spielen, zu wechseln und zu ironisieren. Slavoj Zizek formuliert das paradox: „Der Mann ist eine Frau, die laubt, dass sie existiert.“ – er hängt am Glauben an eine Essenz, die es nicht gibt.
Wenn euch nun noch nicht der Kopf schwirrt, können wir auch die Frage klären, warum auch Frauen hin und wieder nicht wissen, was sie vom Phänomen halten sollen. Einerseits könnte das natürlich als unattraktiv wahrgenommen werden, weil auch Frauen kulturell darauf geprägt werden, einen ‚echten‘ Mann begehrenswert zu finden. Die Illusion einer echten Männlichkeit wird von der Performanz entzaubert. Die Psychoanalyse betrachtet Liebe und Begehren immer als etwas Unsichtbares, um das, was nicht vollständig ergriffen werden kann. Wenn ein Mann aber ständig seine ‚guten Werte‘ performt, wirkt es wie ein Witz, bei dem der Erzähler sofort fragt: ‚War das lustig? Bitte lacht!‘ – der Zauber ist weg.“
Meine Abschlussthese ist also: Der ‚performative male‘ ist zwar nicht so feministisch wie er scheint. Die Frage ist, nimmt Man(n) die Fremdbezeichnung ‚performative male‘ selbst für sich an, oder widerspricht er dieser Zuschreibung. Die Maskerade scheitert daran, wenn zugleich an dem Glauben an eine ‚wahre‘ Männlichkeit festgehalten wird. Gerade darin zeigen sich die Brüche des bestehenden Geschlechterdiskurses und es zeigt sich die Fragilität.
Historische Perspektive
Für die Geschichtswissenschaft eröffnet dieser psychoanalytische Zugang neue Möglichkeiten. Historikerinnen und Historiker können untersuchen, wie sich Maskeraden und Inszenierungen von Geschlecht in unterschiedlichen Epochen wandelten und welche sozialen Funktionen sie erfüllten. Weiblichkeit und Männlichkeit erscheinen dann nicht als feste Größen, sondern als performative Praktiken, die in konkreten historischen Kontexten stabilisiert, angefochten oder transformiert wurden.
Im deutschen Kaiserreich wurden Männlichkeitsbilder stark über Uniform, militärische Gestik und den Habitus des „Bürgersoldaten“ performt. Authentizität wurde hier über Härte und Pflichtbewusstsein inszeniert – eine Maskerade, die die gesellschaftliche Dominanz des Mannes stabilisierte. Im viktorianischen England galt Weiblichkeit als moralische Instanz. Frauen trugen enge Korsetts und bewegten sich in klar definierten häuslichen Rollen – ein performatives Ideal, das weniger ihre „wahre Natur“ abbildete, sondern gesellschaftliche Erwartungen sichtbar machte. In den Frauenbewegungen der 1970er Jahre nutzten Aktivistinnen ironische Maskeraden, etwa die Übersteigerung traditioneller Weiblichkeitscodes, um deren Konstruiertheit offenzulegen. Sie spielten bewusst mit den Symbolen, die zuvor als „natürlich“ galten.
Der heutige performative male lässt sich somit in eine längere historische Genealogie von Geschlechterinszenierungen einordnen. Er ist weniger ein Bruch mit der Vergangenheit als vielmehr ein aktuelles Beispiel für ein fortwährendes Muster: Geschlecht wird in jeder Epoche gespielt, verhandelt und neu definiert.
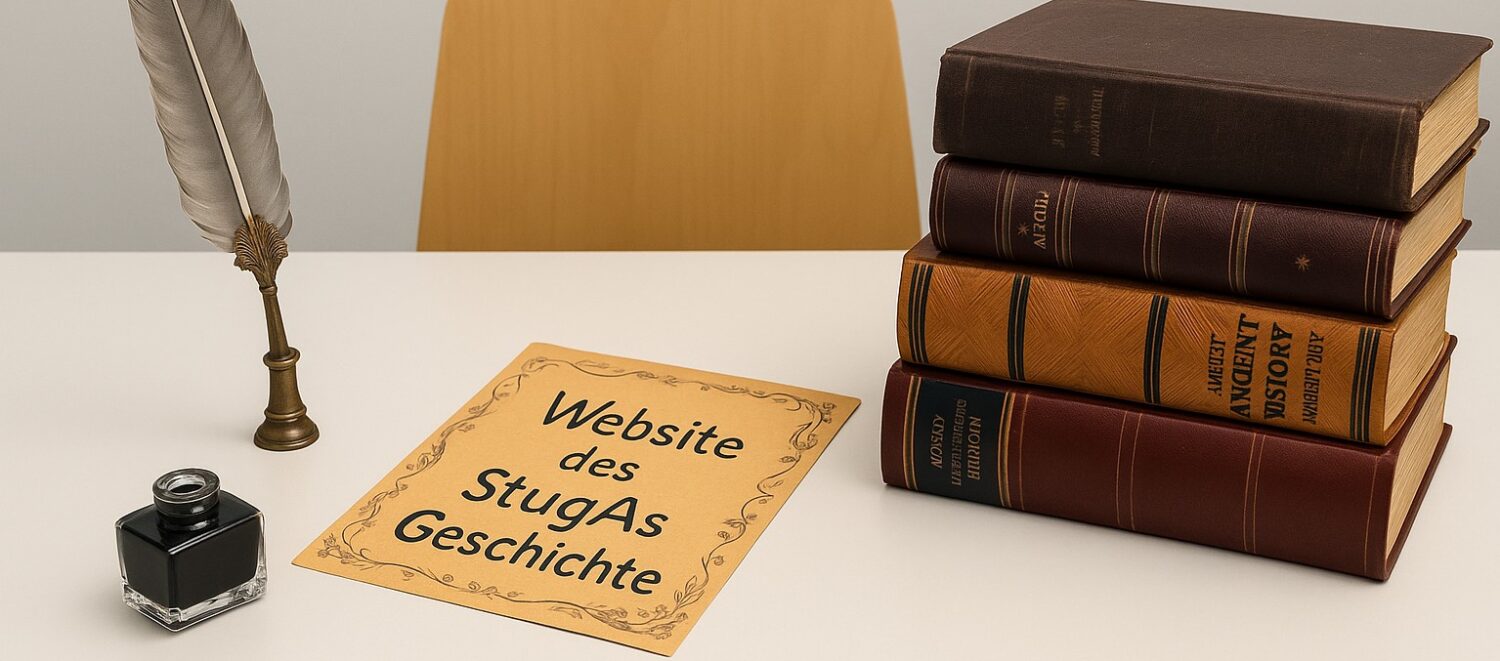
Antworten