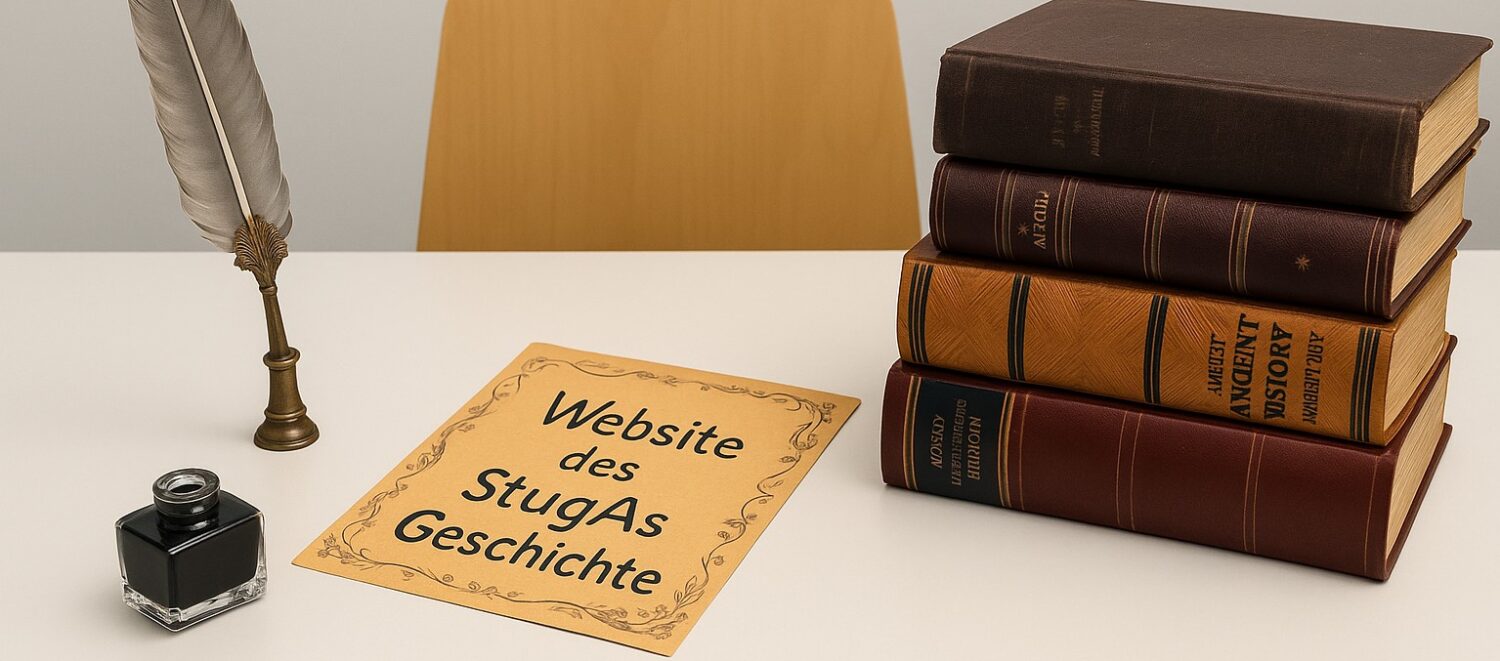In dieser Rubrik „Theorie Shortcut“ möchte ich Euch eine Abkürzung zu wichtigen Theorien und ihren Anwendungsmöglichkeiten für geschichtswissenschaftliche (Haus-)Arbeiten geben. Die Grundlagentexte verschiedener Theorien und Methodiken erfordern ein hohes Maß an Kontextwissen und aufgrund ihrer Fachsprache auch viel Aufmerksamkeit. Gerade für Anfänger im Geschichtsstudium sollen die Artikel dieser Rubrik einen Fingerzeig auf zentrale geschichtsphilosophische Spannungsfelder sein, anhand derer ihr in Euren eigenen Arbeiten argumentieren könnt. Durch ein einfaches „inwiefern…“ habt ihr noch keine offene und geeignete Fragestellung. Diese Artikel geben Euch aber vielleicht eine Inspiration, welches Raster an eine Quelle angelegt werden könnte.
Ein sehr interessantes Theoriegebilde für Eure nächste Hausarbeit könnte die Theorie sozialer Praktiken sein. Dafür gibt es einen zentralen deutschsprachigen Aufsatz von Soziologen Andreas Reckwitz, der äußerst fruchtbare Perspektiven zur Analyse alltäglicher Handlungsweisen für Geschichtswissenschaftler:innen darstellt. Die Theorie lässt sich also sehr gut im Kontext der Alltagsgeschichte anwenden. Die Theorie versteht die Gesamtheit zwischenmenschlicher Beziehungen und Verhältnisse (das Soziale) nicht als bloßes Ereignis individueller Akte (agency) oder normativer Regelungen (Strukturen). Die kleinste soziale Einheit ist laut dieser Theorie verortet in den „kollektiven, routinierten Bündeln von Aktivitäten“.
Warum sollen ausgerechnet die menschlichen Handlungen und nicht die Menschen selbst oder ihre sozialen Systeme stehen? – Andreas Reckwitz und die Denker, die er zitiert, sagen, dass bereits eine alltägliche Handlung viele Voraussetzungen enthält. Eine simple Gewohnheit wie das Kaffeekochen, erfordert vielleicht beim ersten Mal ein hohes Maß an Konzentration, doch nach einer Weile schlägt es in einen Automatismus um. Das Kaffee „wach macht“ oder „einfach zum Frühstück dazugehört“ gerät darüber in den Hintergrund, es ist also implizit.
Das Leben besteht aus einer Vielzahl sozialer Praktiken, die erlernt und weitergegeben werden und somit die Grundlage für die Vielzahl sozialer Beziehungen bestimmen. Zusammengefasst können bei einer Analyse also drei Aspekte dazu herangezogen werden:
- Materielle Dinge: Welche Gegenstände werden genutzt, um ein Bündel von Aktivitäten auszuführen?
- Wissen und Fähigkeiten: Welches praktische Können und Wissen muss gelernt sein, um die Tat zu vollführen?
- Bedeutung und Regeln: Was ist die kulturelle Bedeutung dieser Praxis?
Historiographische Anwendungsmöglichkeiten
Praktiken sind historisch wandelbar. D. h., dass sie als permanent verändernde soziale Muster weiterentwickeln, vergessen werden oder tatsächlich gleich bleiben. Dann wäre wiederum zu erforschen, wer oder welche Erfindung darauf eingewirkt hat, dass sich Praktiken verändert haben.
Die Theorie sozialer Praktiken ist selbst durch historische Forschung entstanden und von Soziolg:innen übernommen worden. Michel Foucault und Judith Butler waren maßgeblich an ihrer Etablierung in den Sozialwissenschaften beteiligt. Judith Butlers ‚Performativität‘ der Geschlechtlichkeit zeigt sehr gut, dass man(n) nicht eben gleich Mann ist, sondern durch Praktiken, die mit Männlichkeit assoziiert, ausführen können muss. Praktiken sind identitäts- und sinnstiftend. Sie werden ständig reproduziert, verhandelt und neu verstanden
Die Aufgabe der historischen Analyse bestünde nun darin, Geschlecht als eine Demonstration von „know-how-abhängigen“ Akten zu deuten. Die Konzentration auf das, was auf kleinster Ebene passiert, erlaubt vielleicht, das eigene Beispiel in einen Gegensatz zu großen sozialen Konstrukten zu setzen. Genau dieses Verhältnis zu großen homogenisierenden Kulturmodellen zu entwickeln, wird von Euch in einer Hausarbeit in der Geschichtswissenschaft erwartet. Diese Perspektive erlaubt es, historische Phänomene nicht als monolithische, eindeutige Gegebenheiten zu betrachten, sondern als Ergebnis von Aushandlungsprozessen, die durch verschiedene Akteursgruppen geprägt wurden.
In den Quellen werdet ihr nicht alles so eindeutig vorfinden, wie ich es hier beschrieben habe. Dadurch, dass Praktiken implizit sind und nicht benannt werden, erfordert die Anwendung von Euch eine hohe Eigenleistung. Außerhalb der Alltagsgeschichte gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel stehen bei der Analyse der Entstehung und Transformation von Jugendkulturen oder politischen Bewegungen häufig bestimmt Praktiken, wie z.B. die Praxis der Nahrungsverwegierung, im Vordergrund.
Fazit
Somit ist die Theorie sozialer Praktiken zu einem mächtigen Werkzeug für die historische Analyse, das über die bloße Beschreibung von Handlungsregelmäßigkeiten hinausgeht und tiefere Einblicke in die kulturelle und materielle Bedingtheit menschlichen Handelns ermöglicht. Insofern stellt Reckwitz‘ Ansatz eine sozialtheoretische Perspektive dar, die nicht als ein weiteres konkurrierendes Theorienfeld zu betrachten ist, sondern als eine umfassende Grundlage zur Untersuchung der sozialen Welt – und damit auch der historischen Realität – im Lichte konkreter, miteinander verflochtener Praktiken. Dieser Shortcut-Artikel beansprucht keine Vollständigkeit. Der Text von Andreas Reckwitz beinhaltet noch weitere Urteile über die Wechselwirkungen von Menschen und Dingen, die ebenfalls im historischen Kontext sehr ertragreich sein können. Daher meine Empfehlung: Betrachtet euren Forschungsgegenstand einmal im Kontext des practice turns. Falls dieser Text Euch nicht weiterhelfen konnte, so hoffe ich doch, dass ihr beim nächsten Mal versteht was mit dem Begriff „praxeologisch“ in einem Text gemeint ist.
überarbeitet am 24.02.2025